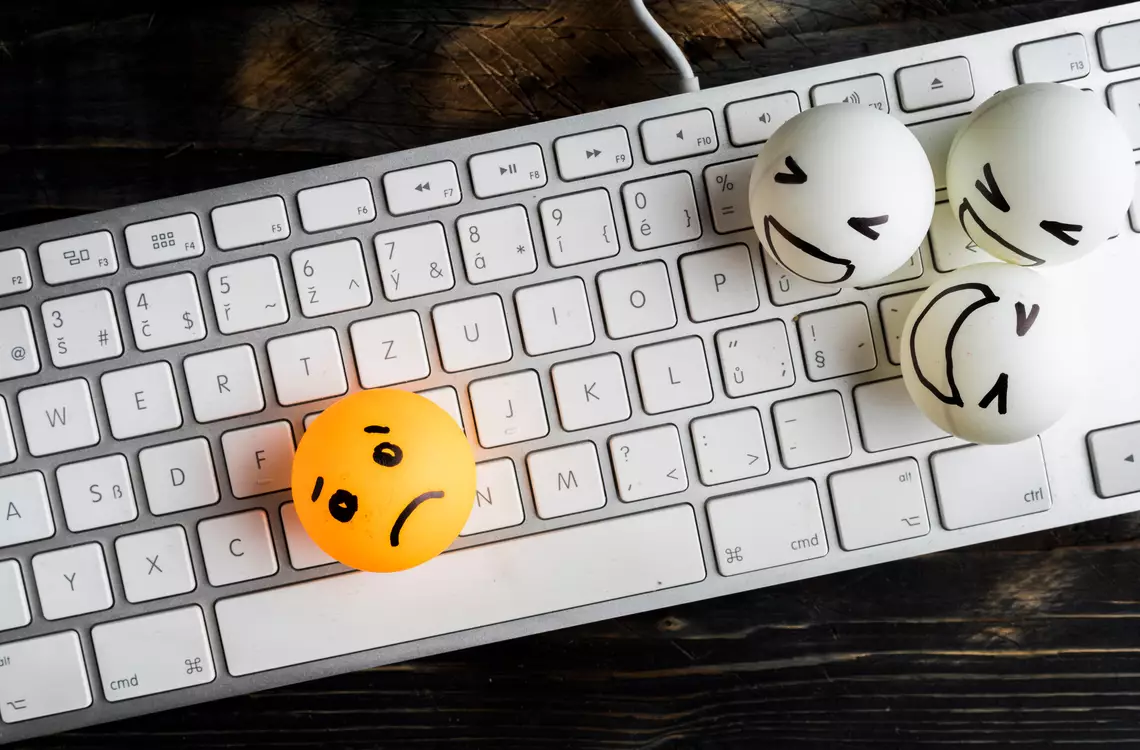
Cybermobbing betrifft heute viele Kinder und Jugendliche. Dazu gehören Hänseleien, Beleidigungen, Drohungen oder das Verbreiten von Gerüchten im Internet. Wenn digitale Medien gezielt eingesetzt werden, um andere zu verletzen, können die Folgen gravierend sein. Es ist daher wichtig, Anzeichen frühzeitig zu erkennen und zu wissen, wie sich Betroffene schützen lassen.
Cybermobbing bezeichnet jede Form von Mobbing über digitale Kanäle wie Nachrichten, soziale Netzwerke, Foren, Online-Spiele oder Messenger-Dienste. Typische Handlungen sind wiederholte Beleidigungen, Drohungen, Demütigungen, das Verbreiten von Gerüchten oder das Veröffentlichen privater Inhalte ohne Zustimmung.
Im Unterschied zum „klassischen“ Mobbing hört Cybermobbing nicht nach Schulschluss auf. Es kann rund um die Uhr und von überall stattfinden, selbst im eigenen Zuhause. Die psychischen Folgen reichen von Stress und Angst über den Verlust des Selbstvertrauens bis hin zu sozialer Isolation.
Bei jungen Menschen hängen Cybermobbing und Mobbing in der Schule oft zusammen. Angriffe im Internet setzen reale Konflikte fort oder verschärfen sie.
In der Schweiz schützen verschiedene Gesetze vor Cybermobbing. Je nach Fall können Beleidigung, Verleumdung, Bedrohung, Ehrverletzung oder Nötigung strafbar sein. Umso wichtiger ist es, schnell zu handeln:
- Anzeichen erkennen
- Das Gespräch suchen
- Beweise sichern und problematische Inhalte melden
Neben Schutzmassnahmen geht es auch darum, Kinder und Jugendliche zu stärken, damit sie sicher im Netz agieren, Risiken einschätzen und respektvoll miteinander umgehen.
- Auf emotionale und verhaltensbezogene Warnsignale achten, zum Beispiel Stimmungsschwankungen, Rückzug oder Angst vor dem Blick aufs Handy.
- Offene Gespräche fördern und deutlich machen, dass es keine Schwäche ist, Hilfe zu suchen.
- Beweise sichern, etwa durch Screenshots und Nachrichten oder Beiträge abspeichern. Diese können für Meldungen oder Anzeigen wichtig sein.
- Inhalte bei den jeweiligen Plattformen melden.
- Bei schweren Fällen wie Bedrohungen, massiver Belästigung oder Verbreitung intimer Bilder die Polizei einschalten.
Mädchen sind statistisch häufiger von Cybermobbing betroffen, insbesondere im Bereich Aussehen oder Privatsphäre.
- Cybermobbing kann schon in jungen Jahren stattfinden, sobald Kinder Zugang zu sozialen Netzwerken oder Messengern haben.
- Verharmlosung („Das ist doch nur virtuell“) kann die Situation verschlimmern.
- Jede*r kann betroffen sein, auch beliebte oder gut integrierte Jugendliche.
- Zwischen Online- und Offline-Welt gibt es keine klare Trennung.
- Direkte Antworten an Täter*innen verschärfen oft den Konflikt.
Cybermobbing bleibt für Erwachsene oft unsichtbar. Viele Jugendliche sprechen nicht darüber, aus Scham, Angst vor Strafe oder weil sie sich unverstanden fühlen.
Plötzliche Veränderungen sollten aufmerksam machen. Typische Anzeichen sind Stimmungsschwankungen, Angst, sozialer Rückzug, Schulverweigerung, Schlafstörungen oder der Verlust von Interesse an Hobbys.
Die Angriffe möglichst schnell stoppen. Beweise sichern, Inhalte auf der Plattform melden, blockieren und bei schweren Vorfällen wie intimen Inhalten oder Todesdrohungen die Polizei informieren.
In der Schule können psychologische Dienste oder Sozialarbeitende unterstützen.
Zuhause sollte ein sicherer Rückzugsort sein, an dem belastende Inhalte möglichst nicht präsent sind.
Ja. Mitunter beteiligen sich Jugendliche an Spott oder teilen verletzende Inhalte, ohne die Wirkung zu bedenken. Frühzeitige Aufklärung über die Folgen ist entscheidend.
Nicht in jedem Fall, aber bei schweren Situationen kann sie sinnvoll sein. Eine Anzeige hilft, die erlittene Belastung offiziell festzuhalten und juristisch zu verfolgen.
